Was ist Storytelling und warum steigert es Reichweite und Engagement
von Carsten Rossi | 06.02.2024 08:00:00 | 10 Minuten Lesezeit

von Carsten Rossi | 06.02.2024 08:00:00 | 10 Minuten Lesezeit

Seit einigen Jahren spricht nahezu jeder von Storytelling (und wir tun das im INVITE Framework auch). Doch ehrlich gesagt ist es dadurch als Thema und Praxis nahezu beliebig geworden. Irgendwie ist mittlerweile alles Story. Aber um das volle Potenzial nutzen zu können, muss man meines Erachtens ein paar Grundlagen und die Mechanismen des Storytellings im Details verstehen. Man sollte vor allem wissen, warum es eigentlich wirkt - und sich erst dann den Formaten zuwenden. Nur mit dem richtigen Hintergrundwissen wird Storytelling zu einem wirklich leistungsstarken Werkzeug, um die Reichweite von und das Engagement auf Content Hubs – vom Corporate Blog bis zum Intranet – zu steigern.
Es ist davon auszugehen, dass Angebote wie der in den Edge Browser eingebaute Bing Copilot die ohnehin sinkenden Click-Through-Rates (CTRs) von Suchmaschinen auf Content-Hubs verringern werden. Dies bedeutet, dass es für den traditionellen „mehrwertigen Content-Hub“ immer schwieriger wird, seinen Return on Investment (ROI) nachzuweisen. Angesichts dieser veränderten Dynamik stellt sich die Frage: Wie können sich Content-Hubs in Zukunft die Aufmerksamkeit ihres Publikums sichern und es langfristig an sich binden? Die Antwort könnte meines Erachtens im Konzept der „Content Communities“ liegen.
Der Begriff „Story“ hat viele Bedeutungen und Facetten. Ein Journalist versteht darunter zunächst das besonders berichtenswerte Ereignis oder den interessanten Vorgang, über den zu schreiben sich für ihn oder seine Publikation lohnt. Ist sein Text schließlich veröffentlicht, ist mit „Story“ das veröffentlichte Werk selber gemeint. Ein Social Media Nutzer versteht unter einer „Story“ eine Abfolge von Bildern, Videos und Texten, die nach 24 Stunden wieder von der Plattform seiner Wahl (z.B. Instagram oder Facebook) verschwinden. Ein Nutzer großer Datenmengen meint die faszinierende, visuelle Präsentation von statistischen Fakten als sogenannte „Data-Story“. Ein Fotograf die „Geschichte hinter dem Bild“. Der Leser eines Romans bezeichnet damit den Inhalt des Buches, das er gerade liest. Umgangssprachlich meinen wir damit ganz allgemein jede Form von Erlebnis, von dem uns jemand erzählt. Und Marketing Manager tendieren im Moment noch unspezifischer dazu, alles was eine Art „Wow-Effekt“ erzeugt, als Story zu bezeichnen.
Wenn ich von „Story“ und von „Storytelling“ im Kommunikationskontext rede, meine ich damit etwas sehr spezifisches und umfassendes zugleich. Eine Story ist für mich „die spannungsvolle Darstellung einer Entwicklung aus einer persönlichen Perspektive“. Oder, spezifischer im Unternehmenskontext, als Business Storytelling: „die spannungsvolle Darstellung einer marken-, unternehmens- oder produktbezogenen Entwicklung aus der Perspektive eines Mitarbeiters oder Kunden“. Diese Definition ist auf der einen Seite spezifisch, weil sie drei Anforderungen an eine Darstellung stellt, bevor sie als Story klassifiziert werden kann:
Dennoch ist diese Definition zugleich umfassend, weil sie Raum für viele verschiedene Formate und Kanäle lässt. Sie legt nicht fest, dass eine Story Bilder oder Videos braucht. Auch ein einfacher Text oder ein Vortrag ist ausreichend. Sie legt auch nicht fest, wo sie erzählt wird: In einem Raum, auf einer gedruckten Seite, in einem Social Network, alle Kanäle sind möglich. Und diese Definition gibt auch nicht vor, welche Länge eine Story haben muss: Sie kann in 60 Sekunden erzählt sein oder in zwei Stunden. Völlig egal.
Zugleich taugt sie aber durchaus dazu, Nicht-Story- von Story-Formaten zu trennen: Die beschreibende Darstellung eines Produktes, wie wir sie in Flyern finden, ist keine Story. Eine Anekdote über die Probleme bei der Nutzung des Produktes schon. Die Beschreibung eines Hotelzimmers ist keine Story. Die Erzählung der persönlichen Erlebnisse während des Aufenthaltes sind es schon eher. Eine Pressemitteilung über die Berufung eines neuen CEO ist sicher keine Story. Ein Interview mit ihm über die ersten 100 Tage im Unternehmen kann durchaus eine sein. Natürlich kann man die Anekdote, die Erzählung und das Interview auch so gestalten, dass ihr wichtige Story-Elemente fehlen. Im Unternehmensumfeld gehen gerade die Konflikte und damit die Spannung gerne verloren. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird klar, was ich meine: Eine Story ist immer persönlich und nicht neutral; sie beschreibt die Lösung eines Problems und nicht nur die Sachlage; sie präsentiert eine Veränderung und keinen Zustand.
Natürlich können sie sich an dieser Stelle fragen: Warum soll ich mich überhaupt um diese Definition scheren? Was bringt mir das?
Meine Antwort ist: Weil sie Ihnen sehr pragmatisch hilft, diverse Herausforderungen im Alltagsgeschäft zu bewältigen.
Denn eine nach meinen Kriterien gut erzählte Story hat drei Eigenschaften, die im geschäftlichen Umfeld von unschätzbarem Wert sind:
• Storys verbinden: Hat Ihre Story einen (echten oder fiktiven) menschlichen Protagonisten, verschafft sie Ihnen einen direkten Zugang zu den Emotionen Ihrer Zielgruppen, besser als jedes andere Format, jede noch so erhellende Statistik oder Infografik. Diese Verbindung ist ein unschätzbarer Vorteil in einem Kommunikationsmarkt, der geprägt ist von Skepsis gegenüber Werbung und Marken.
• Storys sind eingängig: Wenn Sie den für Storys typischen Plot nutzen, müssen sie gar nicht viel sagen, schreiben oder zeigen. Ihr Publikum wird Sie instinktiv und nach kurzer Zeit (!) verstehen. In einem Kommunikationsmarkt, der von „snackable content“ und einem Mangel an Aufmerksamkeit geprägt ist, ist das ein enormer Wettbewerbsvorteil.
• Storys motivieren: Die storytypischen Konflikte und die „eingebaute Dramatik“ sorgen nicht nur für Sympathie, sondern bewirken am Ende auch Verhaltensänderungen bei Ihren Zielgruppen. Sie steigern z.B. die Spenden-, Kauf- und Veränderungsbereitschaft. Die Spannung von „echten Storys“ hilft Ihnen also, Ihre Ziele zu erreichen.
Wir haben mittlerweile viele wissenschaftliche Belege dafür, dass es vorteilhaft ist, die eigene Botschaft nicht durch Behauptungen oder Fakten sondern mit Hilfe eines authentischen, menschlichen Protagonisten zu vermitteln.
Einer der für mich wichtigsten Stichwortgeber in diesem Zusammenhang ist Daniel Kahneman, ein israelisch-amerikanischer Psychologe, Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger, der in seinem Buch „Schnelles Denken. Langsames Denken“ an vielen Beispielen belegt, dass unser Gehirn auf manche Dinge sehr schnell und instinktiv reagiert, auf andere wiederum nur sehr langsam und durch bewusste Anstrengungen.
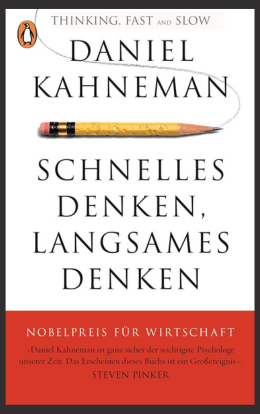
Der Grund dafür ist, dass unser Gehirn mit zwei Systemen, „System 1“ und „System 2“ genannt, ausgestattet ist.
System 1 kann man nicht abschalten, es ist immer aktiv und ist für vieles von dem verantwortlich, was wir „Intuition“ nennen. Es ist für schnelle Eindrücke und spontane Gefühle zuständig.
System 2 hingegen muss man in gewisser Weise erst aktivieren, bevor es nützlich wird. Dafür kann es dann logische Schlüsse ziehen oder Statistiken interpretieren.
Für uns ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass das „automatische“ System 1 neben vielen anderen Dingen sehr gut in der Einschätzung menschlicher Emotionen ist. Wir erkennen sofort, wenn jemand sauer auf uns ist und können entsprechend reagieren. Viel mühsamer ist es für unseren Geist hingegen, mit Hilfe von System 2 eine Tabelle oder eine statistische Grafik zu interpretieren und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Einfacher gesagt: Wir haben dank eines stets wachen Systems 1 und eines recht trägen Systems 2 einen sehr instinktiven Zugang zu Menschen und ein eher angestrengtes Verhältnis zu Fakten.
Wenn Sie also eine Geschichte entwerfen, die mit einem authentischen, menschlichen Protagonisten arbeitet, haben sie schon mehr als die halbe Miete in der Tasche. Denn Ihre Leser oder Zuschauer haben einen sehr instinktiven Zugang zu Menschen. Wenn dieser Protagonist dann auch noch sympathisch ist, sind sie höchstwahrscheinlich ganz auf der sicheren Seite. Denn dank des sogenannten „Halo-Effekts“ werden die Menschen diese Sympathie auf sie oder ihre Marke übertragen. System 1 neigt nämlich dazu, eine spontane emotionale Kohärenz herzustellen. Jeder, der Ihren Protagonisten mag und Sie als Absender identifiziert, wird sie zunächst mal ebenfalls sympathisch finden – selbst wenn Sie es eigentlich nicht sind. Auch deshalb lassen sich Unternehmen und Marken gerne mit positiv konnotierten Stars und Influencern sehen.
Unterstützt werden Kahnemans psychologische Forschungen übrigens auch auf neurowissenschaftlicher Ebene, und zwar durch den Nachweis der sogenannten „Spiegelneuronen“. Spiegelneuronen sind spezielle Nervenzellen im Gehirn, eine Art Resonanzsystem, das es uns ermöglicht, mit unseren Mitmenschen zu fühlen. Wenn sich ein Mensch in unserer Nähe freut oder wenn er Schmerz empfindet, erleben wir ganz unwillkürlich die gleichen Emotionen – wir spiegeln sie. Diese Nervenzellen machen uns erst zu den mitfühlenden Wesen, die wir in der Regel sind – wir sind prädisponiert dafür, uns mit Geschichten von und über Menschen zu identifizieren.

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe interessanter Forschungsarbeiten rund um das Thema Storytelling. Einige davon beschäftigen sich sehr intensiv mit unserem Hormonhaushalt. Von Interesse für uns sind dabei besonders die Forschungen des amerikanischen Neuro-Ökonomen Paul Zak. Zusammen mit einem Kollegen produzierte er zwei unterschiedliche Versionen eines Films. Die eine folgte einem „dramatic arch“, also einem klassischen Spannungsbogen mit Konflikten. Die andere Version hatte die selben Protagonisten, verzichtete allerdings auf jede Form von Spannung. Während die „konfliktlose“ Version keinerlei messbare Hormonausschüttungen bewirkte, sorgte die dramatische Variante für einen vermehrten Ausstoßt von Cortisol und Oxytocin. Dazu muss man wissen, dass Cortisol ein sogenanntes „Stresshormon“ ist, das den menschlichen Organismus durch das Freisetzen von energiereichen Verbindungen wacher und konzentrierter macht, während Oxytocin für die Verstärkung von sozialen Bindungen und die positive Identifikation mit anderen Menschen verantwortlich gemacht wird.
Vereinfacht könnte man also sagen: Dramatisierte Geschichten bewirken bei den Rezipienten, dass sie fokussierter bei der Sache sind und sich mit den handelnden Personen stärker identifizieren als langweilige Storys. Interessant ist dabei besonders, dass die so erzielte Wirkung noch über die eigentliche Geschichte hinausweist. In anderen Studien von Zak konnte nachgewiesen werden, dass die Identifikation mit den handelnden Personen auch zu einem nachträglich veränderten Verhalten führte. Erhöhte Oxytocin-Werte führten bei einer Studie in Großbritannien z.B. zu einer höheren Spendenbereitschaft und sogar insgesamt höheren Spenden. Probanden mit höheren Oxytocin-Werten spendeten fast das dreifache des durchschnittlichen Betrages. Die stärkere Identifikation mit einem/einer Protagonist/in beeinflusst Menschen also auch im Alltag.
Diese Tendenz belegen übrigens auch andere, eher ökonomisch ausgerichtete, Studien. Eine Untersuchung des Magazins „Adworld“ wies nach, dass solche Online-Angebote, die bewusste Identifikationsangebote machen, höhere Preise erzielen, als rein faktische Angebot. So erzielten Hotels, die persönliche Geschichten von Gästen in die Beschreibungen Ihrer Zimmer integrierten, einen im Durchschnitt 5% höheren Zimmerpreis als solche, die nur die üblichen Details über Fläche, Ausstattung und Möblierung machten. Weinflaschen, die nicht nur mit Hilfe von beschreibenden Texten angeboten, sondern die mit Biographien der Winzer angereichert wurden, konnten 8% teurer verkauft werden. Gemälde, die umfangreiche Hintergrundinformationen zu den Malern mit in die Präsentation einbezogen, erzielten einen um 11% höheren Preis. Und eine Kurzgeschichte, die einer eBay Kleinanzeige für Löffel beigefügt wurde, führte zu 64% höheren Geboten.
Storys öffnen aber nicht nur die Taschen unserer Mitmenschen, Kollegen und Mitarbeiter. Sie öffnen auch ihre Herzen, oder anders gesagt: Geschichten können die Einstellungen zu schwierigen Themen verändern und damit Veränderungsprozesse in Gang setzen. Ein sehr schönes Experiment dazu hat die medizinische Fakultät der PennState University 2013 mit Medizinstudenten im vierten Jahr durchgeführt. Dazu muss man wissen, dass die meisten Mediziner ein eher distanziertes Verhältnis zu Demenzkranken haben. Zum einen, weil es sehr schwierig ist, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, also z. B. ein diagnostisches Gespräch mit Ihnen zu führen. Zum anderen, weil Mediziner Demenzkranken kaum helfen können. Es gibt kaum wirksame Medikamente für diese Gruppe von Patienten. Kurz: Angehende Ärzte fühlen sich Demenzkranken gegenüber oft hilflos und halten deshalb bewusst oder unbewusst Abstand von dieser Personengruppe.
Um diese Einstellung zu verändern, brachte man eine Gruppe von Medizinstudenten der PennState Universiät dazu, 4 Wochen lang Gruppen von je 5-10 Demenzkranken in Storytelling-Sessions unter dem Titel „TimeSlips“ anzuleiten. In diesen Runden wurden zunächst ausgewählte surreale Bildern – z.B. ein Elefant auf einer Parkbank – präsentiert. Anschließend wurden alle Teilnehmer dazu aufgefordert, zu beschreiben, was auf dem jeweiligen Bild zu sehen war. Jede Beschreibung oder Bemerkung – auch solche, die wenig oder keinen direkten Bezug zum Bild hatten – wurden notiert und im Anschluss in eine Art kollaborativem Gedicht mit aufgenommen. Anders gesagt: Jeder Teilnehmer konnte seiner Fantasie freien Lauf lassen und seine Imagination wurde zum Teil einer gemeinsam erzählten Geschichte.
Die Ergebnisse dieses Experiments waren beeindruckend: Zum einen waren die Sessions selber wider Erwarten ein voller Erfolg auf einer sehr persönlichen Ebene. Es entstanden sehr lebhafte Gruppengespräche und ein freundliches und offenes Miteinander aller Beteiligten, auch der Medizinstudenten. Vor allem aber veränderte das Experiment die Einstellung der Mediziner zum Thema Demenz und zu Demenzkranken. Auf der sogenannten „Dementia Attitudes Scale“, mit der die Einstellungen der Beteiligten zum Thema Demenz wissenschaftlich gemessen wurde, verbesserten sich die Werte im Laufe des Experimentes kontinuierlich.
Kurz und gut: Storytelling kann nicht nur dazu dienen, Produkte zu verkaufen, sondern auch Veränderungen zu erklären und anzuleiten. Es ist ein Mittel sowohl für die externe als auch für die interne Kommunikation, fürs Marketing und fürs Change Management, für Corporate Blogs genauso wie für Intranets. Egal also, ob sie einen „Change“ oder ein Produkt „verkaufen“ wollen – Storys können helfen, die Haltung ihrer Zielgruppen in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Man könnte zum Thema Storytelling – wie viele andere – ein ganzes Buch schreiben. Aber mir reicht es schon, wenn Sie für den Moment folgendes verstanden haben: Storytelling, definiert als die spannungsgeladene Darstellung einer Entwicklung aus einer persönlichen Perspektive, kann ein wichtiges und zentrales Instrument zur Steigerung der Reichweite und des Engagements auf und von Content Hubs sein. Mit seiner Fähigkeit, emotionale Verbindungen herzustellen, Komplexität zu reduzieren und Inhalte eingängig zu gestalten, ermöglicht Storytelling eine tiefe und nachhaltige Interaktion mit dem Publikum. Kommunikatoren, die Storytelling nutzen, können ihre Botschaften wirkungsvoller vermitteln, stärkere Bindungen aufbauen und somit signifikant zu höherer Reichweite und verstärktem Engagement auf ihren Plattformen beitragen.
Wenn Sie gewinnen oder gewinnend sein wollen, erzählen Sie!
PS.: Wenn Sie mehr zum Thema Storytelling erfahren wollen, lege ich ihnen unsere INVITE Community ans Herz. Dort finden sie u.a. Auszüge aus meinem Online-Video-Kurs zum Thema Storytelling sowie diverse Whitepaper zu erfolgreichen Storytelling-Formaten. 👇
Feature Bild wurde mit Midjorney erstellt.